Inst. für Geschichte und Ethik der Medizin der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg und Inst. für Geschichte der Medizin der TU Dresden; Christian König und Florian Bruns (Web)
Zeit: 01.10.2024
Ort: Halle (Saale)
Einreichfrist: 15.07.2024
Zum 270. Mal jährt sich 2024 die Promotion von Dorothea Christiana Erxleben an der Medizinischen Fakultät der damaligen Friedrichs-Universität zu Halle (Saale). Die Veranstalter:innen möchten dies zum Anlass nehmen, uns aus medizinhistorischer Perspektive mit Frauen in Gesundheitsberufen zu beschäftigen. So sehr die Leistung von Dorothea Erxleben zu würdigen ist, so klar ist auch, dass sie in ihrer Zeit eine absolute Ausnahme darstellte. Ein regulärer oder gar gleichberechtigter Zugang für Frauen zu akademischer medizinischer Bildung und Berufstätigkeit ließ noch mehr als 150 Jahre auf sich warten. Gleichwohl – auch das zeigt Erxlebens Beispiel – waren Frauen vielfach heilberuflich tätig: als Ärztinnen, Hebammen, Pflegende, Hilfskräfte usw.
Im Zentrum der Konferenz soll die vielfältige Entwicklung beruflicher Tätigkeitsfelder für Frauen im Gesundheitsbereich stehen. Besonderes Augenmerk soll auf das 20. Jhd. und die Zeit der deutschen Teilung mit den divergierenden Gesellschaftsentwürfen in Ost und West gelegt werden. Die Systemkonkurrenz und der strukturelle Umbau des Gesundheitssektors veränderten Rollenzuschreibungen, Bildungs- und Berufsmöglichkeiten. Welche Faktoren beeinflussten die Entscheidung von Frauen, einen Beruf im Gesundheitswesen zu ergreifen? Inwiefern unterschied sich die berufliche Entwicklung von Frauen in Gesundheitsberufen im Vergleich zu Männern? Wie sah der Alltag und die Zusammenarbeit innerhalb und über die Grenzen der Berufsgruppen hinweg aus? Mit welchen Hemmnissen bei Berufswahl und -ausübung sahen sich Frauen konfrontiert? Wie wirkte sich die geschlechtsspezifische Verteilung von familiären Aufgaben und beruflichen Verantwortlichkeiten auf die Zufriedenheit und das Wohlbefinden von Frauen in Gesundheitsberufen aus? Zu diesen und weiteren Fragen sind lokale Fallstudien ebenso wie übergreifende Analysen erwünscht. Continue reading

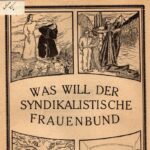 Vortragsreihe „Geschichte am Mittwoch“
Vortragsreihe „Geschichte am Mittwoch“  Frauen*solidarität, UZF*G, STICHWORT und Frauenhetz
Frauen*solidarität, UZF*G, STICHWORT und Frauenhetz 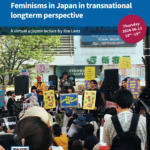 Lecture Series des Instituts für Japanologie der Univ. Wien
Lecture Series des Instituts für Japanologie der Univ. Wien  Department of Ethnic Studies at California State Univ.
Department of Ethnic Studies at California State Univ.  13. Landesweiter Tag der Genderforschung in Sachsen-Anhalt
13. Landesweiter Tag der Genderforschung in Sachsen-Anhalt  Ringvorlesung des Referats Genderforschung an der Univ. Wien; Organisation: Tomi Adeaga
Ringvorlesung des Referats Genderforschung an der Univ. Wien; Organisation: Tomi Adeaga  Wienmuseum
Wienmuseum