 ofra: online archiv frauenpolitik – Projekt des Bruno Kreisky Archivs|Johanna Dohnal Archivs (Web)
ofra: online archiv frauenpolitik – Projekt des Bruno Kreisky Archivs|Johanna Dohnal Archivs (Web)
Die zweite Frauenbewegung machte seit Ende der 1960er-Jahre Geschlechterdifferenz, geschlechtsspezifische Diskriminierung und Emanzipation (wieder) zum politischen Thema. In diesem Kontext veränderte sich auch die Frauenpolitik der staatlichen Institutionen stark. Das Johanna Dohnal Archiv und das Bruno Kreisky Archiv haben Originaldokumente aus dem Umfeld dieser institutionellen Frauenpolitik in seinen Beständen. Auf der Website „ofra“ wird eine Auswahl von Papieren, Fotografien und Plakate online zur Verfügung gestellt und in kurzen Dossiers kontextualisiert. Die Präsentation ist dabei nach den folgenden Themen gestaltet:
– Partizipation (Web)
– Bildung (Web)
– Reproduktion (Web)
– Arbeit (Web)
– Heim und Herd (Web)
– Frauentag (Web)
– Frauenwahlrecht (Web)
Institutionalisierte Frauenpolitik in Österreich
In den 1970er Jahren wurde das neue Politikfeld “Frauenpolitik” auch in Österreich institutionalisiert: Seit 1971 durch ein Staatssekretariat für “Familienpolitik und Frauenfragen” im Bundeskanzleramt. 1979 ernannte Kanzler Bruno Kreisky vier neue Staatssekretärinnen, zwei davon für die Belange von Frauen: Franziska Fast im Sozialministerium und Johanna Dohnal im Bundeskanzleramt. Sie war die damalige Wiener Frauensekretärin der SPÖ, ihre Position wurde 1990 zur Bundesministerin aufgewertet. Anfang 2000 wurde das Ministerium abgeschafft, 2006 wieder eingeführt.
“Gleichberechtigung” war das zentrale Thema institutioneller Frauenpolitik in den 1980er- und 1990er-Jahren, “institutionalisierte” Frauenpolitik war und ist allerdings nicht ohne die autonome Frauenbewegung denkbar. In historischer Perspektive erweisen sich “autonome” und “institutionalisierte” Frauenpolitik als unterschiedliche Konzepte, die sich von einander abgrenzen, sich aber gegenseitig brauchen, um denkbar und machbar zu sein. Das wird auch an vielen der auf ofra präsentierten Dokumente sichtbar.
ofra begreift sich als “work in progress”: Die Datenbasis wird weiterhin ausgebaut und durch Dokumente ergänzt.

 Frauenmuseum Hittisau
Frauenmuseum Hittisau  Abteilung Ariadne an der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)
Abteilung Ariadne an der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)  Institut für Historische Sozialforschung
Institut für Historische Sozialforschung  Wien Museum
Wien Museum  insightOut. Journal on Gender and Sexuality in STEM Collections and Cultures
insightOut. Journal on Gender and Sexuality in STEM Collections and Cultures  Frauenmuseum Hittisau
Frauenmuseum Hittisau 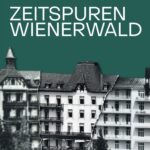 Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung und Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich
Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung und Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich 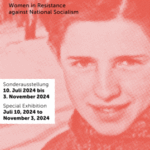 Gedenkstätte Deutscher Widerstand
Gedenkstätte Deutscher Widerstand  Waschsalon Nr. 2
Waschsalon Nr. 2