 Ö1-Schwerpunkt „Widerstand“, Reihe „Frauen gegen Faschismus“ in „Betrifft Geschichte“ (Web)
Ö1-Schwerpunkt „Widerstand“, Reihe „Frauen gegen Faschismus“ in „Betrifft Geschichte“ (Web)
Zeit: bis 14.08.2025, 17:55 Uhr
Ort: Radiosender Ö1
Auf Ö1 ist bis 14. August 2025 von Montag bis Donnerstag täglich je ein kurzer Ausschnitt aus Interviews mit 16 Widerstandskämpferinnen zu hören. Sie übten Sabotage in der Fabrik, schufen illegale Kommunikationsnetze, kämpften als Partisaninnen oder schlossen sich der Résistance an.
Die Interviews wurden in den 1980er-Jahren von Karin Berger, Karin Holzinger, Lotte Podgornik sowie Lisbeth N Trallori geführt und in Auszügen in dem inzwischen legendären Film „Küchengespräche mit Rebellinnen“ (A 1984, Web) und dem ebenfalls berühmten Buch „Der Himmel ist blau. Kann sein. Frauen im Widerstand. Österreich 1938-1945“ veröffentlicht. Das Buch wurde 2023 im Promedia Verlag neu aufgelegt (Web).
Radioreihe „Frauen gegen Faschismus“
Interviewerinnen: Karin Berger, Elisabeth Holzinger, Lotte Podgornik und Lisbeth N Trallori | Redaktion: Ulrike Schmitzer | Gestaltung: Karin Berger | Nach der Ausstrahlung können die kurzen Beiträge (jeweils ca. 5 Minuten) online nachgehört werden (Web):
- Hermine Jursa (21.07.2025) (Web)
- Irma Schwager (22.07.2025) (Web)
- Antonie Lehr (23.07.2025) (Web)
- Friedl Burda (24.07.2025) (Web)
- Helene Kuchar-Jelka (28.07.2025) (Web)
- Johanna Saldoschek-Zala (29.07.2025) (Web)
- Gusti Hölzl (30.07.2025) (Web)
- Marianne Feldhammer, Maria Plieseis und Leni Egger (31.07.2025) (Web)
- Rosl Grossmann-Breuer (04.08.2025) (Web)
- Anni Haider (05.08.2025) (Web)
- Martha Raffelsberger (06.08.2025) (Web)
- Helene Potet (07.08.2025) (Web)
- Hilda Stampfl und Franziska Haas (11.08.2025) (Web)
- Agnes Primocic (12.08.2025) (Web)
- Irma Trksak (13.08.2025) (Web)
- Hanna Sturm (14.08.2025) (Web)
Weiteres Thema im Schwerpunkt „Widerstand“ in der Reihe „Betrifft: Geschichte“
„Bedrohte Natur – Ziviler Ungehorsam. Zur Geschichte des Umweltschutzes in Österreich“, 28.07.-02.08.2025 (Web)

 Transit. Der Podcast zur Migrationsgeschichte“; Franziska Lamp-Miechowiecki und Philipp Strobl, Institut für Zeitgeschichte der Univ. Wien
Transit. Der Podcast zur Migrationsgeschichte“; Franziska Lamp-Miechowiecki und Philipp Strobl, Institut für Zeitgeschichte der Univ. Wien  fernetzt. Verein zur Förderung junger Forschung zur Frauen- und Geschlechtergeschichte
fernetzt. Verein zur Förderung junger Forschung zur Frauen- und Geschlechtergeschichte  i.d.a. Dachverband deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen
i.d.a. Dachverband deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen  The many futures of gender: Oral Histories of Feminist Theory; Patricia Purtschert
The many futures of gender: Oral Histories of Feminist Theory; Patricia Purtschert 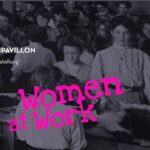 Technisches Museum Wien
Technisches Museum Wien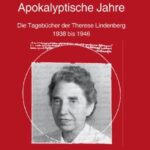 Reihe „Zweiter Weltkrieg. Ein Ö1 Schwerpunkt aus Anlass der 80. Wiederkehr des Endes des Zweiten Weltkriegs“
Reihe „Zweiter Weltkrieg. Ein Ö1 Schwerpunkt aus Anlass der 80. Wiederkehr des Endes des Zweiten Weltkriegs“ Webportal „Erinnerungsort Wien“; Bruno Kreisky Archiv und Johanna Dohnal Archiv
Webportal „Erinnerungsort Wien“; Bruno Kreisky Archiv und Johanna Dohnal Archiv  Frauen- und Geschlechtergeschichte in Österreich – Newsletter #01 für 2024
Frauen- und Geschlechtergeschichte in Österreich – Newsletter #01 für 2024