30. Fachtagung des Arbeitskreises Geschlechtergeschichte der Frühen Neuzeit (Web)
Zeit: 23.-25.10.2025
Ort: Stuttgart – Tagungszentrum Hohenheim
Einreichfrist: 15.04.2025
In den letzten Jahren ist die Bedeutung von Kindern in den frühneuzeitlichen Gesellschaften zunehmend in den Fokus historischer Untersuchungen gerückt. Obwohl Kinder ein wesentlicher Bestandteil jeder Gesellschaft und damit auch ihrer jeweiligen Geschlechterordnungen waren und sind, wurden sie von den Geschichtswissenschaften lange vernachlässigt – teils aufgrund historiographischer Tendenzen, teils wegen Herausforderungen in der Quellenüberlieferung. Kinder hinterlassen nicht die gleichen Spuren in historischen Quellen wie Erwachsene, und ihre Geschichten müssen in der Regel aus Texten, Bildern und anderen Quellen rekonstruiert werden, in denen sie – oft auch nur en passant – erwähnt werden. Je jünger ein Kind ist, desto sichtbarer wird es tendenziell nur durch die Handlungen anderer. Nichtsdestoweniger erkennen Historiker*innen zunehmend die immanente Relevanz dieser demografischen Gruppe – sei es für die Erforschung grundlegender frühneuzeitlicher Themen wie Geschlecht, Religion bzw. Konfession, Stand, Arbeit und Arbeitsteilung oder auch Bildung, generationelle Ressourcenverteilung und politische Macht. Kindheitsforschung ist zu einem integralen Bestandteil der historischen Forschung geworden.
Während die Forschung zu Kindern schon für sich bedeutsam ist, bietet der Zugang über Kinder, als Akteur*innen konzipiert, auch eine distinkte Perspektive auf andere Themenfelder. Die Aspekte der Abhängigkeit, die zur relativen Vernachlässigung von Kindern in den historischen Wissenschaften geführt haben, können breitere soziale und kulturelle Logiken deutlicher hervortreten lassen: Auch Kinder sind in Netzwerke eingebettet; ihre Abhängigkeiten von Erwachsenen und ihre eingeschränkten Möglichkeiten, eigenständige Entscheidungen zu treffen, erforderten eine stärkere und andere Einbindung in Netzwerke und Akteurskonstellationen. Bei entsprechender Aufmerksamkeit werden Kinder dennoch auch in der Frühen Neuzeit immer wieder als eigenständige Akteur:innen greifbar – und sind als solche also auch sichtbar zu machen. Historische Kinderforschung bedeutet daher, die Perspektiven von Kindern ebenfalls ernst zu nehmen und Bedürfnisse, Motive und Aktionen von Nicht-Erwachsenen, soweit die Quellenlage es zulässt, aufzuzeigen.
Kinder, Kindheit und Kind-Sein ist in der Frühen Neuzeit daher in einem dichten Gefüge aus rechtlichen und sozialen Abhängigkeiten und Ungleichheiten zu untersuchen, welche nicht nur unterschiedliche Lebensphasen, sondern auch Geschlecht, Zugehörigkeiten, Emotionalitäten und Teilhabe an materiellen und immateriellen Ressourcen betreffen. Continue reading

 Lilith: A Feminist History Journal
Lilith: A Feminist History Journal  Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit
Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit 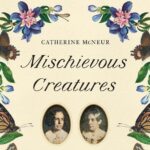 Library of Congress: „Made at the Library“
Library of Congress: „Made at the Library“  Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung (VGA)
Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung (VGA)  Zeitschrift soziales_kapital
Zeitschrift soziales_kapital  Frauenmuseum Hittisau
Frauenmuseum Hittisau