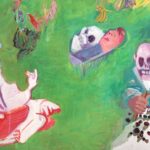 Dom Museum Wien (Web)
Dom Museum Wien (Web)
Laufzeit bis: 25.08.2025
Ort: Dom Museum Wien, Stephansplatz, 1010 Wien
Die Ausstellung befasst sich mit dem unausweichlichsten Bestandteil jeder Existenz: „Sterblich sein“ spürt mittels Gegenüberstellung von Kunstwerken, die einen kulturhistorischen Bogen vom Mittelalter bis zur Gegenwart spannen, der tiefen Bedeutung von Tod nicht nur im individuellen, sondern auch im kollektiven und gesellschaftspolitischen Kontext nach. Intime, persönliche Ansätze werden genauso beleuchtet wie die öffentliche, politische Rolle des Sterbens und die Auseinandersetzung damit.
Auch aus der legendären Sammlung Otto Mauer (Web) wird eine umfangreiche Auswahl an grafischen Arbeiten gezeigt. Es bietet sich daher die Gelegenheit für einen spannenden Einblick in die Sammlungstätigkeit dieser Schlüsselfigur für die Kunstszene der österreichischen Nachkriegszeit.
Mit Werken von Kurt Absolon, Khaled Barakeh, Max Beckmann, Renate Bertlmann, Margret Bilger, Nomin Bold, Jan Brueghel d. J., Günter Brus, Maria Bussmann, Lovis Corinth, Ramesch Daha, Stefano della Bella, Alexandre Diop, Otto Dix, Albin Egger-Lienz, Ameh Egwuh, James Ensor, Manfred Erjautz, Olia Fedorova, Hans Fronius, Ernst Fuchs, María Galindo & Danitza Luna, Nikolaus Gansterer, Domenico Gargiulo, gen. Micco Spadaro, Giovanni Giuliani, Ferdinand Hodler, Sam Jinks, Alfred Kubin, Maria Lassnig, Sybille Loew, Teresa Margolles, Meister der Zvíkover Beweinung (?), Meister des Albrechtsaltars, Kurt Moldovan, ORLAN, Dan Perjovschi, Arnulf Rainer, Johann Elias Ridinger, Christian Rohlfs, Anton Romako, Anja Ronacher, Tina Ruisinger, Walter Schels & Beate Lakotta, Eva Schlegel, Tom Schmelzer, Lena Ilay Schwingshandl, Phil Solomon, Petra Sterry, Timm Ulrichs, Francesca Woodman, Herwig Zens sowie historische Künstler*innen, deren Namen nicht überliefert sind.
Kuratorin: Johanna Schwanberg | Ko-Kurator: Klaus Speidel | Kuratorische Assistenz: Anke Wiedmann

 Sektion Historische Pflegeforschung (HPF) und DRK Landesverband Sachsen e.V., Anja Katharina Peters
Sektion Historische Pflegeforschung (HPF) und DRK Landesverband Sachsen e.V., Anja Katharina Peters  Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi (AISA) and the universities of Ljubljana and Capodistria; Margareth Lanzinger and Aleksander Panjek
Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi (AISA) and the universities of Ljubljana and Capodistria; Margareth Lanzinger and Aleksander Panjek  Museum für Geschichte, Graz
Museum für Geschichte, Graz 
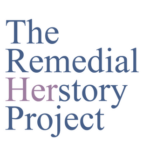 Remedial Herstory: A Journal of Women’s History for Educator
Remedial Herstory: A Journal of Women’s History for Educator  Tijdschrift voor Genderstudies
Tijdschrift voor Genderstudies  Österreichische Gesellschaft für Geschlechterforschung (ÖGGF)
Österreichische Gesellschaft für Geschlechterforschung (ÖGGF)  Gender Campus
Gender Campus