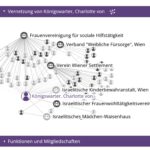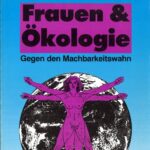ZARAH: Women’s labour activism in Eastern Europe and transnationally (Web)
ZARAH: Women’s labour activism in Eastern Europe and transnationally (Web)
In February 2020, the ERC-advanced-grant-project ZARAH project started. ZARAH explores the history of women’s labour activism and organizing – from the age of empires to the late 20th century. The aim is to present the working conditions and living conditions of lower class and working class women and their communities and to move these women from the margins of labour and gender studies and European history to the centre of historical research. The Austrian part of this histories is worked out by Veronika Helfert. Read more … (Web).
ZARAH weblog
In September 2020, the ZARAH weblog started. The first blog series were „Finding Women in the Sources“, „Putting Activists Centre Stage“ and „Transnational Links“. The first post in the ZARAH Guest Blog Series went online in November 2022 (Web):
Series IV: Through the Lens of Women’s Work and Activism: ZARAH Guest Blog Series
- Selin Çağatay and Jelena Tešija: Through the Lens of Women’s Work and Activism: Introducing the ZARAH Guest Blog Series
- Jessica Richter: “Bitter Years of Exploitation”: Domestic Workers’ (Un)organized Labour Struggles (1890s-1938)
- Minja Bujaković: Establishing the Communist Women’s Movement in the 1920s: Individual Activism and the Activist Networks
- Doreen Blake: The representations of work in the Catholic women’s press in Austria (1918-1934)
- Ivana Mihaela Žimbrek: Women’s Organizing and Household Work in Socialist Yugoslavia (1950s-1960s)
- Adela Hîncu: The “Feminization of Agriculture”: Rural Women, Family Structures, and the Political Economy of State Socialist Romania Continue reading

 Women and Social Movements in the United States, 1600-2000; Thomas Dublin and Kathryn Kish Sklar
Women and Social Movements in the United States, 1600-2000; Thomas Dublin and Kathryn Kish Sklar  i.d.a. Dachverband deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen
i.d.a. Dachverband deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen  STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung
STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung  Vortragsreihe „biografiA – Neue Ergebnisse der Frauenbiografieforschung“; Susanne Blumesberger, Ilse Korotin und Christine Kanzler
Vortragsreihe „biografiA – Neue Ergebnisse der Frauenbiografieforschung“; Susanne Blumesberger, Ilse Korotin und Christine Kanzler