 Lilith: A Feminist History Journal (Web)
Lilith: A Feminist History Journal (Web)
Proposals by: 28.02.2025
Lilith remains the only Australian journal solely dedicated to the publication of feminist history. The editors are excited to announce that Lilith has completed 40 years since its first publication in 1984 and invite submissions for the 2025 issue. They are looking for thought-provoking and insightful contributions from new and established scholars in the field. Lilith publishes articles (peer-reviewed) and reviews in all areas of women’s, feminist and gender history dealing with topics both in Australia and internationally. The journal is based in Australia, but welcomes reviewers from outside of Australia, as well as reviews of books engaging with local and global histories of gender. As a platform that values diverse voices and visibilities, Lilith particularly encourages submissions from Australian and international postgraduate students and early career researchers.
Lilith is available open access here (Web)
The edotirs welcome research articles (6000-8000 words including footnotes) that align with the journal’s interest in historical research on gender. Please note that Lilith only publishes articles that constitute an original piece of research. Thus, the editors will only accept articles that are not under review or scheduled for publication by other journals, and that are substantially different from other published work. All articles are peer reviewed, and only those that pass the review process are published. Referencing should be done using the Chicago Manual of Style and footnotes. All submissions should be double-spaced, use Australian-British spelling (see Macquarie Dictionary) and include an abstract of no more than 200 words.
Original article submissions should be emailed to lilithjournal@gmail.com and conform to the Submission Guidelines (PDF).
Source: H-Net Notifications

 Zeitschrift soziales_kapital
Zeitschrift soziales_kapital  Frauenmuseum Hittisau
Frauenmuseum Hittisau  Global Black Thought
Global Black Thought  Verein für Geschichte der Stadt Wien
Verein für Geschichte der Stadt Wien  Webportal „Erinnerungsort Wien“; Bruno Kreisky Archiv und Johanna Dohnal Archiv
Webportal „Erinnerungsort Wien“; Bruno Kreisky Archiv und Johanna Dohnal Archiv 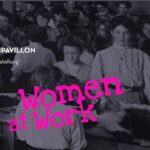 Technisches Museum Wien
Technisches Museum Wien „Die andere Seite der Verfolgung. Selbstzeugnisse des 19. und 20. Jhds. revisited“
„Die andere Seite der Verfolgung. Selbstzeugnisse des 19. und 20. Jhds. revisited“