Johannes Gutenberg-Univ. Mainz, Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft (IKM), Jennifer Jasmin Konrad (Web)
Zeit: 26.-27.03.2025
Ort: Univ. Mainz
Einreichfrist: 15.02.2025
Mit der Entwicklung von höfisch-profaner Literatur und einer Etablierung von Skriptorien fernab der Klöster, ist ein Anstieg erotischer bis sexuell konnotierter Darstellungen in der Kunst allgemein und speziell in der Buchmalerei des Mittelalters feststellbar. Während im 12. und 13. Jhd. profane Bildthemen ikonografisch aus der christlichen Kunst hervorgehen, findet man im fortschreitenden 14. und 15. Jhd. eine freiere Entwicklung von zwischenmenschlichen Darstellungsweisen vor, wobei „frei“ sowohl im Sinne von künstlerischer Freiheit als auch Anzüglichkeit verstanden werden kann. Die Darstellung von Sexualität und Erotik in der Kunst im Hoch- und Spätmittelalter unterliegt damit einem faszinierenden Wandel, der transmedial bis in die frühe Neuzeit reicht und darüber hinaus wirkt. Dieser Veränderungsprozess ist geprägt durch komplexe Wechselwirkungen sozialer, gesellschaftlicher und religiöser Art: Neben dem Etablieren einer moraltheologischen Leitlinie für das Führen einer Ehe im decrretum gratiani, der ersten Liebeslyrik und Entwicklung von Liebestraktaten wie de amore von Andreas Capellanus, definiert sich darüber hinaus ein eigenes Ideal der höfischen Liebe, das sich in Helden- und Minneromanen ausdrückt. Faszinierend sind die Widersprüche bzw. Nachbarschaften unterschiedlicher Auffassungen von Liebe, Erotik und sexuellem Begehren: von der Ehe als ökonomisches Arrangement, der göttlichen Liebe als die einzige wahre Liebesform und der Sehnsucht nach körperlich-seelischer Annäherung, die sich gleichermaßen, wenn auch unterschiedlich ausgerichtet, in der profanen Literatur sowie sakralen Mystik wiederfinden lässt. Die daraus definierten Geschlechterrollen können jedoch in den Text- und Kunstwerken nicht minder widersprüchlich und subversiv unterwandert werden. Mit den fließenden Grenzen von Zeig- und den immer explizit werdenden Motiven wird deutlich, dass die in der Kunstgeschichte vielfach behandelten erotischen Darstellungen noch weit vor dem 16. Jhd. auf eine ikonografische Tradition blicken können, vielmehr noch die erotischen Darstellungen der sog. Renaissance auf einer ikonografischen Tradition des Mittelalters beruhen müssen, die sich mit der Profanisierung von Literatur und Kunst wenige Jahrhunderte davor entwickelt. Es bleibt zu hinterfragen, inwiefern ein Bruch mit der Kunst des sogenannten „Mittelalters“ vorliegt, wenn nicht vielmehr Verbindungslinien und Reflexionen zu antiken und mythologischen Themen nachweisbar sind, die weit über eine einseitige ikonografische Umwandlung einer antiken Venus in „Frau Minne“ reichen. Weiterlesen und Quelle … | English version (Web)

 Project „Light On! Queer Literatures and Cultures under Socialism“, Univ. of Regensburg, Tatiana Klepikova
Project „Light On! Queer Literatures and Cultures under Socialism“, Univ. of Regensburg, Tatiana Klepikova  Österreichischen Gesellschaft für Exilforschung (öge), QWien – Zentrum für queere Kultur und Geschichte und Österreichische Exilbibliothek
Österreichischen Gesellschaft für Exilforschung (öge), QWien – Zentrum für queere Kultur und Geschichte und Österreichische Exilbibliothek  Global Black Thought
Global Black Thought  Abteilung Ariadne an der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)
Abteilung Ariadne an der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)  Verein für Geschichte der Stadt Wien
Verein für Geschichte der Stadt Wien 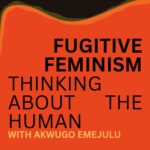 IPW-Lecture WiSe2024, Gender & Politics: Inst. für Politikwissenschaft, Univ. Wien, Lehrstuhl Geschlecht und Politik: Dorit Geva
IPW-Lecture WiSe2024, Gender & Politics: Inst. für Politikwissenschaft, Univ. Wien, Lehrstuhl Geschlecht und Politik: Dorit Geva