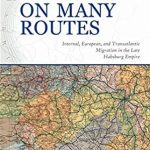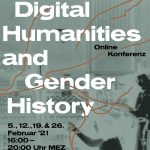DFG-Projekt: Nationaljüdische Jugendkultur und zionistische Erziehung in Deutschland und Palästina zwischen den Weltkriegen (TU Braunschweig/HU Jerusalem) (Web)
DFG-Projekt: Nationaljüdische Jugendkultur und zionistische Erziehung in Deutschland und Palästina zwischen den Weltkriegen (TU Braunschweig/HU Jerusalem) (Web)
Ort: virtueller Raum, via Berlin
Zeit: 04.-06.03.2021
Anmeldung bis: 19.02.2021
Jüdische Jugendkulturen und Jugendbewegungen entwickelten sich auch im Zusammenhang eines neuen Jugendbegriffes, der sich um die Wende zum 20. Jhd. im deutschsprachigen Raum Mitteleuropas etablierte. Ein Gefühl des Aufbruchs und die Suche nach eigenen Wegen kennzeichneten die beteiligten jugendbewegten Generationen. Ihre Antworten auf die Fragen nach jüdischer Tradition und Zukunft, nach nationaler, religiöser und sozialer Gemeinschaft sowie nach einer neuen Erziehung und nach einem gerechten Verhältnis der Geschlechter waren vielgestaltig, zum Teil auch kontrovers.
In den Beiträgen der Konferenz werden Aspekte dieser Bewegungen aufgenommen und um transnationale und gender-spezifische Perspektiven auf intergenerationale Prozesse und die historisch-politischen Rahmenbedingungen der Zwischenkriegszeit erweitert. Im Mittelpunkt stehen dabei Traditionen, Vielfalt und Internationalität der jüdischen Jugendbewegungen, Hachschara und (Jugend-)Alija sowie Entwicklungen zionistischer Erziehungsvorstellungen zwischen Mitteleuropa und Palästina.
Programm (als PDF)
Do., 04.03.2020
- 10:00 Uhr: Ofer Ashkenazi und Ulrike Pilarczyk (HU Jerusalem/TU Braunschweig): Begrüßung
10.45 Uhr: Break/Pause
11.05 Uhr: Panel 1: Wegmarken. Zionistische Ideen und Erziehungskonzepte zwischen Deutschland und Palästina
- Rose Stair (Univ. of Oxford): “Jungjüdisch” Zionism: the German cultural Zionist construction of youth in its generational and gendered context
- Esther Carmel-Hakim (Univ. of Haifa): Dr. Chana Maisel and Agricultural Training for Young Women
- Moderation: Moshe Zimmermann