![Booklet-Cover via Website [Zum Vollbild anklicken]](https://salon21.univie.ac.at/wp-content/uploads/Booklet_WiSe_2018_ausschnitt-740x763-150x150.jpg) Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse, Goethe Universität Frankfurt am Main – Cornelia Goethe Colloquien im Wintersemester 2018/19 (Web)
Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse, Goethe Universität Frankfurt am Main – Cornelia Goethe Colloquien im Wintersemester 2018/19 (Web)
Orte: Historisches Museum Frankfurt und Goethe-Universität Frankfurt
Zeit: 24.10.2018-06.02.2019
Historische Ereignisse werden anlässlich ihrer ‚runden‘ Geburtstage gefeiert und zelebriert. Häufig wird bei solchen Jubiläen ein Gedenken inszeniert, das aus historischen Ansichten des Mainstream gespeist wird und zur Kanonisierung von Geschichte beiträgt. Dabei steht dann eher das Passförmige und Konsensfähige im Vordergrund, während Unangepasstes im Hintergrund bleibt, nicht selten ausgeschlossen wird. Mit unserer Hinwendung zu einer „Erinnerungskultur“ sollen einige Stolpersteine solcher Jubiläumsmarathons aus dem Weg geräumt werden.
Ein bewusstes Erinnern an historische Ereignisse, Personen, Netzwerke und Prozesse rekurriert auf historische Diskurse, aber auch auf private und politische Erfahrungen; es umfasst Reflexe des kollektiven und sozialen Gedächtnisses einer Gesellschaft. Insofern bezieht sich Erinnerungskultur auf Geschichte, ermöglicht aber immer auch eine Selbstvergewisserung über die Gegenwart. Die „Feminist Memory Studies“ haben mit ihrer Kritik an einer hegemonialen Erinnerungskultur, die insbesondere Großereignissen und Mächtigen nachgeht, wichtige neue Impulse gesetzt. Sie erforschen die Geschichte von Feminismus und Frauenbewegung, reflektieren Erinnern, Erfahrung und Gedächtnis und fragen explizit auch nach … weiterlesen (Web).
Monthly Archives: Oktober 2018
Klicktipp: Deutsches Digitales Frauenarchiv (DDF) (Portal)
 Deutsches Digitales Frauenarchiv (Web); i.d.a. Dachverband deutschsprachiger Frauen; Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen
Deutsches Digitales Frauenarchiv (Web); i.d.a. Dachverband deutschsprachiger Frauen; Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen
Im September 2018 wurde in Berlin das neue Portal „Deutsches Digitales Frauenarchiv (DDF)“ online geschalten (Link). In diesem Rahmen fand auch die Feministische Sommeruni 2018 (Link) statt.
Das „DDF“ dokumentiert die Geschichte der Frauenbewegungen in Deutschland. Das umfangreiche Portal ist entstanden als mehrjähriges Kooperationsprojekt der verschiedenen Archive, Biliotheken und Dokumentationseinrichtungen, die im Dachverband „IDA“ vernetzt sind (Web). Finanziert wurde das groß angelegte Digitalisierungs-Projekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Auf der Website werden verschiedene Themen in Essays vorgestellt. Derzeit sind 37 Essays online. Diese enthalten neben inhaltichen Informationen auch Bibliografien sowie Links zu ausgewählten Quellen. Die Quellen sind dabei in digitaler Form verfügbar. Es sind Textdokumente, Plakate, O-Töne, Filme etc. Die Quellen und die Literatur sind mit dem gemeinsamen META-Katalog verknüpft (Web). In META können die Bestände der verschiedenen IDA-Einrichtungen gemeinsam recherchiert werden.
- Die Themenschwerpunkte des „DDF“ sind die derzeit folgenden: Politik, Recht & Gesellschaft / Arbeit & Ökonomie / Körper & Sexualität / Gewalt / Kunst, Kultur & Medien / Bildung & Wissen (Web)
Das Portal wird laufend erweitert. Continue reading
Buchpräsentation: Ilse Korotin und Nastasja Stupnicki (Hg.): „Die Neugier treibt mich, Fragen zu stellen.“ Biografien bedeutender österreichischer Wissenschafterinnen, 06.11.2018, Wien
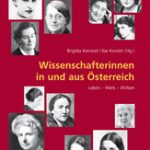 biografiA und Frauenarbeitsgemeinschaft der österreichischen Gesellschaft für Exilforschung
biografiA und Frauenarbeitsgemeinschaft der österreichischen Gesellschaft für Exilforschung
Zeit: Di., 06.11.2018, 18:30 Uhr
Ort: IWK, Berggasse 17, 1090 Wien
Der Band schließt an das 2002 erschienene Lexikon „Wissenschafterinnen in und aus Österreich“ an, in dem u. a. die Wirkungsfelder der ersten Generation von Wissenschafterinnen an den österreichischen Universitäten sowie in außeruniversitären Arbeitsbereichen erforscht wurden.
Die Sammlung konzentriert sich nun vorwiegend auf Wissenschafterinnen nach 1945 (Geburtsjahre 1930–1950), beinhaltet aber auch eine Ergänzung früherer Jahrgänge. Der zeitliche Schwerpunkt umfasst die theoretischen und personellen Auswirkungen der zweiten Frauenbewegung, die sich in den 1970er Jahren an den Universitäten aus frauenspezifischen Fragestellungen im Wissenschaftsbereich entwickelt hat.
Podiumsgespräch
- mit den Herausgeberinnen Ilse Korotin und Nastasja Stupnicki
- sowie den AutorInnen Silvia Stoller (Institut für Philosophie, Univ. Wien),
- Katharina Kniefacz (Forum Zeitgeschichte der Univ. Wien)
- und Horst Aspöck (Medizinische Univ. Wien)
Festveranstaltung: „Sie meinen es politisch!“ 100 Jahre Frauenwahlrecht, 31.10.2018, Wien
 Forschungs- und Ausstellungsprojekt frauenwahlrecht.at (Web)
Forschungs- und Ausstellungsprojekt frauenwahlrecht.at (Web)
Zeit: Mi., 31.10.2018, ab 18.00 Uhr
Ort: Kleinen Festsaal der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien
Mit Präsentation der „wandernden Wahlzelle“ durch die Kurator*innen, Beiträgen von Gabriella Hauch und Elisabeth Holzleithner sowie Julya Rabinowich und mit Musik (Programm und Einladung als PDF)
Das Fest findet im Rahmen des Projekts frauenwahlrecht.at statt. Dieses wird von Expert*innen der Geschichts-, Rechts- und Politikwissenschaft durchgeführt. Aus Anlass der Republiksfeierlichkeiten und der Einführung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts ohne Unterschied des Geschlechts vor 100 Jahren wird dabei folgendes erarbeitet:
- Die „wandernde Wahlzelle“ „Sie meinen es politisch! 100 Jahre Frauenwahlrecht vor Ort“ (Link) als dezentrales Ausstellungsmodul, ab Herbst 2018 an mehreren Orten in Österreich.
- Die Ausstellung „Sie meinen es politisch! 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich“ (Link), ab März 2019 im Volkskundemuseum Wien.
- Der Begleitband zur Ausstellung mit aktuellen Forschungsarbeiten (Link).
Neben dem Kampf von Frauen um ihr Wahlrecht in der Monarchie fokussiert Frauenwahlrecht.at auf Continue reading
Veranstaltungsreihe: Ein anderer Blick. Lesbische Lebenswelten in Berlin, 11-12/2018, Berlin
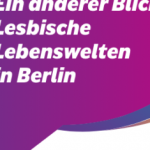 Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH); in Kooperation mit FFBIZ – Das Feministishe Archiv; Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek; Rad und Tat – Offene Initiative lesbischer Frauen und Verein der Freund/innen des Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses (E2H) (Web)
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH); in Kooperation mit FFBIZ – Das Feministishe Archiv; Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek; Rad und Tat – Offene Initiative lesbischer Frauen und Verein der Freund/innen des Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses (E2H) (Web)
Ort: Berlin (verschiedene Veranstaltungsorte)
Termine: 08.11.2018, 29.11.2018 und 13.12.2018
Magnus Hirschfeld hatte sich zeit seines Lebens nicht nur für die Rechte schwuler Männer, sondern ebenso für alle anderen Menschen eingesetzt, deren sexuelle Orientierung und/oder geschlechtliche Identität nicht den heteronormativen Vorstellungen der Zeit entsprach. In heutiger Diktion würde man Hirschfeld durchaus als Streiter der Rechte für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und queere Personen (LSBTTIQ) bezeichnen können. Die BMH möchte sich daran anschließend in einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe mit den Lebenswelten von lesbischen Frauen in Berlin beschäftigen.
Wie haben lesbische Frauen in Berlin gelebt? Welche Rolle spielte ihre sexuelle Identität für ihr Leben? Gab es ein Spannungsverhältnis zwischen dem Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen und dem Kampf um Anerkennung als Lesben? Wie sind lesbische Frauen, die nicht politisch aktiv waren, mit ihrer geschlechtlichen Orientierung umgegangen? Wie haben sie das Verhältnis zu schwulen Männern empfunden? Wie haben sie sich organisiert und Netzwerke aufgebaut? Diese und viele weitere Fragen sollen in drei öffentlichen, moderierten Gesprächen mit lesbischen Frauen zur Sprache kommen. Weiterlesen … (Web).
CfP: (Un)Told Stories (USD Women, Gender & Sexuality Studies Conference 03/2019, SD); DL: 15.12.2018
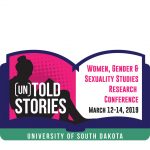 The University of South Dakota’s Women, Gender & Sexuality Studies Program (Web)
The University of South Dakota’s Women, Gender & Sexuality Studies Program (Web)
Venue: University of South Dakota
Time: March 12-14, 2019
Proposals by December 15, 2018
In the past year, the #MeToo movement catalyzed an international discussion about continuing widespread sexual harassment and sexual violence. It has also raised awareness about the context in which stories are told, heard or silenced.
People have asked a variety of questions in efforts to understand how and why marginalized figures are able to speak, be seen and be heard. What role does community play? Narrative and discursive frameworks? Who is being represented and who remains invisible? Where does lack of coverage persist? How does storytelling function as healing and self-care, as a form of resistance, but what risks does it also invite?
This year, the Women, Gender & Sexuality Studies Program invites individuals across disciplines to present their work on (Un)Told Stories and grapple with the personal and societal politics of storytelling at the intersection of gender and sexuality and other marginalized group identities, both today and historically. Read more … (Web)
Der Erste Weltkrieg in Nachlässen von Frauen Nr. 137: Feldpost von Christl Lang und Leopold Wolf, 15. und. 22. Oktober 1918, von einem unbekannten Ort in Italien nach Niederösterreich
 Christine Wolf (geb. Lang, geb. 1891) und Leopold Wolf (geb. 1891) aus Wien waren seit Frühsommer 1917 verheiratet. Seit Winter 1918 waren sie Eltern einer kleinen Tochter. Christine Wolf lebte in den letzten Monaten in einem Ausweichquartier in Niederösterreich. Aus der Feldpost des Paares sind gut 200 Schreiben erhalten. Die zwei am spätesten datierten Schreiben wurden im Oktober 1918 verfasst. Darin geht es um Artzbesuche der jungen Mutter, die Regelung der Gehaltseinstufung als Soldat sowie auch Strategien einer möglichen Versetzung. Der inzwischen als „Autooffizier“ im Rang eines Oberleutnants bei der Artillerie eingestufte Leopold Wolf deutet darin mehrfach an, ein baldiges Ende der Kriegshandlungen zu erwarten.
Christine Wolf (geb. Lang, geb. 1891) und Leopold Wolf (geb. 1891) aus Wien waren seit Frühsommer 1917 verheiratet. Seit Winter 1918 waren sie Eltern einer kleinen Tochter. Christine Wolf lebte in den letzten Monaten in einem Ausweichquartier in Niederösterreich. Aus der Feldpost des Paares sind gut 200 Schreiben erhalten. Die zwei am spätesten datierten Schreiben wurden im Oktober 1918 verfasst. Darin geht es um Artzbesuche der jungen Mutter, die Regelung der Gehaltseinstufung als Soldat sowie auch Strategien einer möglichen Versetzung. Der inzwischen als „Autooffizier“ im Rang eines Oberleutnants bei der Artillerie eingestufte Leopold Wolf deutet darin mehrfach an, ein baldiges Ende der Kriegshandlungen zu erwarten.
15.10. 18.
Liebstes Weibi!
Du wirst Dich natürlich in erster Linie wundern auf wie feinem Briefpapier ich Dir schreibe. Das hab ich gelegentlich der Ausgrabungen in meinem Schreibtisch entdeckt. Nichtsdestotrotz wäre ich schon froh zu wissen wie’s Dir geht. Ich hätte Dir schon in Wien sagen können, Du möchtest statt wegen Deiner Plombe nach Horn, gleich nach Wien fahren, damit Du auch zum Prof. S. gehen kannst. Denn ich denke mir, es wird halt doch besser sein, Du wartest erst nicht lang und läßt Dir ins Augerl schauen, was denn da los ist.
Wozu zuwarten? Die Kleine, die ja hoffentlich wohlbehalten Deine Abwesenheit überstanden hat, wird auch diesmal schön brav sein. Also fahre gleich nach Wien, es wird vielleicht nur auf Augentropfen oder derlei ankommen, bevor vielleicht eine Entzündung oder sonst was Unangenehmes heraus kommt. Ja?
Hier hat mein Vertreter, ein Aspirant, sehr brav gearbeitet, so daß ich schon länger ausbleiben konnte, als ich anfänglich beabsichtigt. In den letzten Tagen hat’s allerdings greulich geregnet, so wie es heute noch fortgeht. In Trient hatten wir zum Nachtmahl – K 2.40! – Hendl mit sehr fetten Makkaroni nach einer Vorspeise – ein Stück Hering. Um 11h nachts, also mit großer Verspätung, war ich hier.
Ich habe – wie die Verhältnisse jetzt liegen – nicht mehr viel zu tun hier, vielleicht gar nichts mehr, was sich morgen oder übermorgen entscheiden wird. Also kann ich beruhigt ins Spital gehen und mein sonst notwendig gewordener Vertreter dorthin, wo der Pfeffer gedeiht.
Nach allem, was ich hier höre und sehe, steht schon alles am Sprung nach rückwärts, man erwartet den Eintritt der unausbleiblichen Veränderungen früher, als man vernünftiger Weise annehmen kann. Jedenfalls bin ich aber immer noch früher dran abzufahren.
Nun kommt eine sehr erfreuliche Mitteilung: Mit dem Ausrüstungsbeitrag {von 150.- K} bin ich, wie ich Dir schon sagte, diesmal wieder Continue reading
Sonderausstellung und Veranstaltungsreihe: Lebenszeichen. Fotopostkarten aus den Lazaretten des Ersten Weltkriegs, 19.10.2018-31.01.2019, Hamburg
 Medizinhistorisches Museum Hamburg; Monika Ankele und Henrik Eßler (Web)
Medizinhistorisches Museum Hamburg; Monika Ankele und Henrik Eßler (Web)
Ort: Medizinhistorischen Museum Hamburg
Zeit: 19.10.2018-31.01.2019
Eröffnung: 19.10.2018, 18.30 Uhr
Eine umfangreiche Sammlung von Postkarten ist Ausgangspunkt dieser neuen Sonderausstellung, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven dem Lazarett als Erfahrungsraum widmet.
Bildpostkarten aus dem Lazarett waren oft das erste Lebenszeichen, das Angehörige von den Verwundeten des Ersten Weltkriegs erhielten. Kommerzielle Fotografen besuchten die Lazarette, fotografierten die Patienten und verkauften ihnen die Bilder als Feldpostkarten. Aber auch die Patienten selbst sowie das Lazarettpersonal machten Aufnahmen, die als Postkarten verschickt wurden. Viele bemühten sich um ein idealisiertes Bild, das den Schreibenden als genesenden und gut umsorgten Patienten zeigte. Doch die Realität des Krieges ist unübersehbar.
Aus medienhistorischer Sicht sind diese Selbstzeugnisse in ihrer Kombination aus Bild und Schrift herausragend. Viele Texte wurden von ungeübten Schreibern verfasst. Zentrale Botschaft war der fotografische Beweis: „Ich lebe noch“.
Ergänzt um … weiterlesen, Programm der Veranstaltungsreihe und Quelle (Web)
Ausstellung: „Im Totaleinsatz. Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung für das Dritte Reich – mit Erweiterung um Zwangsarbeit auf österreichischem Gebiet“, bis 15. März 2019, Wien
 Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien (Web)
Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien (Web)
Ort: Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte, Universitätscampus, 1090 Wien
Laufzeit: bis 15. März 2019
Als das Nürnberger Tribunal den Generalbevollmächtigten für Arbeitseinsatz Fritz Sauckel als „größten und grausamsten Sklavenhalter seit den Pharaonen“ bezeichnete, handelte es sich nicht um eine dramatische Übertreibung. Während des NS wurde die Zwangsarbeit zum Massenphänomen, welches das Leben von Millionen von Menschen im besetzten Europa bestimmte.
Für die deutsche Kriegswirtschaft wurden sowohl zivile Arbeitskräfte, als auch Kriegsgefangene und Gefangene der Judenghettos, der Internierungslager für Roma, der Konzentrationslager und anderer Gefängnisanstalten nutzbringend ausgenutzt. Die Behandlung der zivilen Zwangsarbeiter/innen hing von zeitlichen und örtlichen Faktoren, aber auch von ihrer Stellung in der unübersichtlichen Nazihierarchie von „Rassen“ und Völkern ab. Der härtesten Behandlung waren die Arbeiter/innen aus der Sowjetunion (Ostarbeiter) und die polnischen Zwangsarbeiter/innen ausgesetzt; Arbeiter/innen aus den westeuropäischen Staaten hatten etwas erträglichere Arbeits- und Lebensbedingungen.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden auch mehr als 400 000 Tschech/innen im Ausland eingesetzt. Seit 1942 wurden ganze Jahrgänge junger Menschen aus dem damaligen Protektorat Böhmen und Mähren deportiert. Der Zwangseinsatz wurde zur Erfahrung einer ganzen Generation, die bis heute das kollektive Gedächtnis eines Continue reading
CfP: Kriegstrennungen im Zweiten Weltkrieg – Familienzerstörung zwischen „Kollateralschaden“ und Biopolitik (Event: 07/2019, Hamburg); DL: 10.01.2019
Wiebke Lisner, Institut für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizinischen Hochschule Hannover; Cornelia Rauh, Historisches Seminar der Leibniz Univ. Hannover und Lu Seegers, Historisches Seminar, Univ. Hamburg
Ort: Hanns-Lilje-Haus Hannover
12.-13.07.2019
Einreichfrist: 10.01.2019
Familienleben — als Zusammenleben der Kernfamilie von Vater, Mutter und Kindern — im Bürgertum seit dem 19. Jahrhundert idealisiert und nach dem Ersten Weltkrieg zur gesellschaftlichen Norm erhoben, wurde in Kriegszeiten gleichwohl zur Ausnahme. Temporäre Trennungen bis hin zur endgültigen Zerstörung von Familien waren im Europa des 20. Jahrhunderts die unvermeidliche Folge der immer „totaler“ geführten Kriege, — Begleiterscheinungen des Kriegsdienstes der Männer und „Kollateralschäden“ von Gewalteinsatz, Krankenmorden, Flucht, Vertreibung, Umsiedlung und Tod. Familientrennungen wurden insofern zu einer kollektiven Kriegserfahrung. Trennungsbedingungen und Handlungsoptionen gestalteten sich hierbei für Familien jedoch nicht gleich. Vielmehr generierten gesellschaftliche Kategorien von Differenz, wie „rassische“ Zuordnung, medizinische Kategorisierung und soziale Schichtzugehörigkeit unterschiedliche Bedingungen und Deutungen der Trennungen bis hin zu unterschiedlichen Überlebenschancen. Weiterlesen und Quelle … (Web)
