19. Workshop des Forschungsschwerpunkts Frauen*- und Geschlechtergeschichte der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Univ. Wien; Natascha Bobrowsky, Johanna Gehmacher, Dietlind Hüchtker, Paula Lange, Michaela Neuwirth (Web)
Zeit: 17.10.2025, 10:00-18:00 Uhr
Ort: Univ. Wien, Marietta-Blau-Saal, Universitätsring 1, 1010 Wien
Einreichfrist: 30.08.2025
In regelmäßigen Abständen wird die Frauen*- und Geschlechtergeschichte von außen und innen auf den Prüfstand gestellt: Durch den zunehmenden Rechtsruck ist die Disziplin verstärkt Angriffen ausgesetzt und das Sichtbarwerden von Geschlechtervielfalt lässt Fragen nach der Aktualität von „Frauen“geschichte aufkommen. Gleichzeitig werden geschlechtergeschichtliche Perspektiven vermehrt in historische Forschungen miteinbezogen und sind in interdisziplinären Zusammenhängen kaum mehr wegzudenken. Während in den 1970er und 1980er Jahren wichtige Impulse für Themensetzungen und kritische Fragestellungen aus den Frauenbewegungen kamen, differenzieren sich Perspektiven und theoretische Zugriffe der Frauen*- und Geschlechtergeschichte weiter aus. Dies passiert parallel zu Institutionalisierungsschritten, die wiederum Fragen nach der Unabhängigkeit dieser (macht)kritischen, feministischen Forschungsrichtung aufwerfen. Lange mitgetragene Ambivalenzen und ungelöste Fragen kommen damit in gegenwärtigen Debatten ebenso zum Tragen wie aktuelle Kontroversen. Mit Blick auf Kontinuitäten und Diskontinuitäten des Feldes wollen wir einen Diskurs darüber anstoßen, wie den aktuellen Herausforderungen begegnet werden kann.
Der diesjährige Workshop wird die Historiographie der F*GG reflektieren und Einblicke in die Veränderungen und Impulse der letzten Jahrzehnte geben. Gleichzeitig wird er auch eine Brücke zu heutigen (In)Fragestellungen schlagen und dabei Themenkomplexe in den Blick nehmen, die bei Veranstaltungen bisweilen am Rand angesprochen, aber selten ausdiskutiert werden. Nach einem Impulsvortrag von Caroline Arni und einer Paneldiskussion mit Levke Harders, Elisa Heinrich, Zsófia Lóránd und Falko Schnicke laden wir alle Teilnehmer:innen zu einem Worldcafé ein. In einer abschließenden Plenumsdiskussion werden Ausblicke auf zukünftige Perspektiven besprochen.
Im Rahmen des Worldcafés wird es die Möglichkeit geben, in Kleingruppen intensiver über Herausforderungen und aktuelle Fragestellungen in den Austausch zu kommen. Continue reading

 feministische studien; Tanja Thomas (Tübingen) und Christiane Leidinger (Düsseldorf)
feministische studien; Tanja Thomas (Tübingen) und Christiane Leidinger (Düsseldorf)  fernetzt. Verein zur Förderung junger Forschung zur Frauen- und Geschlechtergeschichte
fernetzt. Verein zur Förderung junger Forschung zur Frauen- und Geschlechtergeschichte 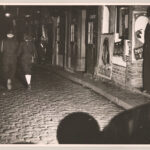 Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)
Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)  i.d.a. Dachverband deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen
i.d.a. Dachverband deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen  INSERT. Artistic Practices as Cultural Inquiries; Ana de Almeida (Academy of Fine Arts Vienna/ÖAW), Lena Ditte Nissen (Univ. of Art and Design Linz/ÖAW), and Elif Süsler-Rohringer (Univ. of Applied Arts Vienna/ÖAW)
INSERT. Artistic Practices as Cultural Inquiries; Ana de Almeida (Academy of Fine Arts Vienna/ÖAW), Lena Ditte Nissen (Univ. of Art and Design Linz/ÖAW), and Elif Süsler-Rohringer (Univ. of Applied Arts Vienna/ÖAW)